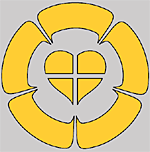Aktuelle Meldung
LD online: Die Kirche bleibt unsere Heimat
Die Lage der Evangelischen Kirche A.B. in Rumänien zwanzig Jahre nach dem Umbruch
von Wolfgang H. Rehner
Auszug aus dem »Lutherischen Dienst« 1/2010

LD 1/2010

Die Kirchenburg in Birthälm, Bischofssitz der sächsisch-evangelischen Kirche von 1572 bis 1867 – Foto: MLB

Viktor Glondys (1932–1941)

Friedrich Müller (1945–1969)

Albert Klein (1969–1990). Diese drei Porträts ehemaliger Bischöfe hängen im großen Saal im Bischofspalais in Sibiu-Hermannstadt in der General-Magheru-Straße.
Vor drei Wochen erschien im Teutsch-Haus in Hermannstadt ein Professoren-Ehepaar aus Japan, das über Fragen der Minderheiten in Rumänien erstaunlich gut informiert war, und stellte mir die Frage, was man in der Evangelischen Kirche A.B. in Rumänien unter »Diaspora« verstehe. Die allgemein gültige Antwort als Gemeinde in der Zerstreuung reichte ihnen nicht aus. Sie wollten wissen, was bei uns ein »Diaspora-Pfarramt« ist, was das »Diaspora-Heim« war und wieso man die Bezeichnung »Diaspora-Kirche« in Siebenbürgen beinahe als eine Art Herabsetzung empfinde. Vor allem die letzte Frage überraschte mich. Zuerst musste ich darüber nachdenken, ob das überhaupt so ist, und dann sah ich mich genötigt, auszuholen und über die Lage der Evangelischen Kirche in Rumänien zu reden, was ihrer Erwartung offenbar entsprach.
Diaspora – eine Herabsetzung?
1861 wurde der Gustav-Adolf-Verein der evangelischen Kirche A.B. in Siebenbürgen gegründet, und zwar nicht bloß als Nutznießer, sondern als Vollmitglied. In diesem Zusammenhang ist es nicht unwesentlich, dass der siebenbürgische Verein schon im ersten Jahr nach seiner Gründung unter den Spendern für den Bau der evangelischen Kirche in Salzburg/Österreich erscheint. Österreich war für die evangelische Kirche in höherem Maße Diaspora als Siebenbürgen, wo die evangelische Kirche A.B. zwar in einem ethnisch und konfessionell gemischten Umfeld lebte, jedoch auf eine kontinuierliche Überlieferung zurücksehen konnte, nicht nur seit der Reformation, sondern auch in der vorausgegangenen katholischen Zeit seit der Ansiedlung im 12. Jahrhundert. In Österreich war die Tradition der evangelischen Kirche durch die Gegenreformation unterbrochen worden. Man genoss wohl die Unterstützung brüderlicher Solidarität, stand aber dennoch auf eigenen Beinen und konnte sich somit als ein im Lande historisch gewachsenes Ganzes verstehen, nicht als Diaspora.
Vor dem Ersten Weltkrieg gab es vereinzelt siebenbürgische Pfarrer, die in Altrumänien, das heißt jenseits der Karpaten, in der Diaspora dienten.
1990, zur Zeit des großen Exodus, hieß es dann angesichts der spektakulär geschrumpften Gemeinden: »Wir leben jetzt alle in einer Diasporasituation.« Das war in unseren Augen keine Herabsetzung, sondern eine Tatsache. Unklar blieb jedoch die Frage, inwieweit wir weitere Diaspora-Pfarrämter einzurichten haben und inwieweit wir uns generell als Diaspora-Kirche betrachten. In diesem Zusammenhang erhob sich die Frage: Lässt sich der Rest einer bodenständigen Kirche so ohne weiteres in eine Außenstelle der EKD verwandeln? Damit verbunden war auch eine zunehmende finanzielle Abhängigkeit, die uns gar nicht behagte, weil sie uns ungesund erschien und unser Selbstbewusstsein trübte. Es ist ein Unterschied, ob man auf eigenen Beinen steht oder am Tropf hängt. Es ist ein Unterschied, ob man zu Hause ist oder in der Fremde. So gesehen gewann die Bezeichnung Diaspora-Kirche für unsere Evangelische Kirche A.B. in Rumänien allerdings auch einen erniedrigenden Beigeschmack, wenn wir dieses zunächst auch gar nicht so empfanden.
Nach dem Zweiten Weltkrieg galt die Südbukowina als das klassische Diaspora-Gebiet unserer Kirche, weil in den Wirrnissen der Nachkriegszeit ein Teil der 1940 umgesiedelten Buchenländer zurückgekehrt waren und dort in noch größerer Zerstreuung lebten als die heimgekehrten Nordsiebenbürger, die ebenfalls in untragbaren Verhältnissen leben mussten. Ab 1993 habe ich vier Jahre lang von Sächsisch-Regen aus die verstreuten Gemeinden jener Gegend betreut. Dabei habe ich wichtige Erfahrungen gemacht, die rückblickend betrachtet recht simpel klingen. In der extremen Diaspora gibt es keine tragenden Gemeindestrukturen, und für verschiedene Kreise und Sonderveranstaltungen hat man keine Zeit. Alle sechs Wochen hielt ich zwischen Freitag und Sonntag an allen sechs verbliebenen Predigtstellen Gottesdienste, zu denen die Leute aus der Umgebung mit Bahn, Bus oder PKW zusammenkamen. Vom Pfarrer erwarteten sie vor allem Pünktlichkeit, Regelmäßigkeit und möglichst viele Hausbesuche. Meine Erfahrung war überraschend: Ich habe mich als Pfarrer in meinem Leben kaum irgendwo so völlig angenommen und jederzeit erwartet gefühlt wie gerade dort. Ich spürte und lernte: Wo die tragende Gemeinde fehlt, ist der Pfarrer als Integrationsperson besonders wichtig. Im Pfarrer spricht man die Kirche an, das ist die Gemeinde, die man nicht mehr sehen kann, weil sie zu sehr verstreut ist.
Von dieser persönlichen Erfahrung komme ich zurück zur Diasporasituation unserer Kirche. Der spektakuläre Rückgang der Seelenzahl zur Zeit des großen Exodus zu Beginn der 90er Jahre verwandelte die gewachsenen Dorfgemeinschaften in kleine Häuflein Zurückgebliebener, vorwiegend ältere Menschen, weil die Jüngeren mit den Kindern weggezogen waren. Daneben ist aber nicht zu übersehen, dass mancherorts durch mutiges Handeln von Pfarrern und Laien Gemeinden neu geordnet und diakonische Einrichtungen ins Leben gerufen wurden, die heute zuweilen sogar das Bild einer lebenden Kirche vermitteln. Und wenn wir uns heute freuen, dass 20 Jahre nach dem Exodus kirchliches Leben wider Erwarten noch erhalten oder neu erwacht ist, so dürfen wir auch nicht verschweigen, dass manches versäumt wurde und dass uns heute ungelöste Fragen bedrücken.
Die Diasporasituation ist keine Herabsetzung, wohl aber eine besondere Herausforderung sowohl an die Pfarrer als auch an alle Laien, die fähig und willig sind, ihre Kirche mitzutragen und ihr zu dienen. Es gilt sowohl den Schatz der besonderen Überlieferung unserer Kirche zu erkennen und zu bewahren als auch neue Wege zu finden und mutig zu beschreiten. Der höchste Lohn solchen Dienstes ist, dass diese Kirche uns weiter Heimat bleibt.
Gehen oder Bleiben
In der Zeit nach dem Umbruch war wiederholt von Öffnung und innerer Wandlung unserer Kirche die Rede, doch blieben diese Begriffe ohne Konturen und konnten in unterschiedlichster Weise ausgelegt werden. Einig war man sich lediglich darin, dass man mit der völlig veränderten Lage irgendwie fertig werden wollte. Eine Reihe diakonischer Projekte wurde gleichsam über Nacht aus der Erde gestampft. Jeder war erfüllt von dem, was vor ihm lag, ging seinen Weg nach eigenem Gutdünken und beurteilte die Lage nach den Eindrücken aus seiner unmittelbaren Umgebung. Selbst Pfarrer, die in neu entstandenen Projekten eingebunden waren, rechneten mit der Auflösung unserer Kirche in drei Jahren. Das Schlagwort vom geordneten Rückzug schwirrte durch die Dechantenkonferenz. Wiederholte Versuche, geistliche Gemeinschaft aufzubauen, scheiterten daran, dass nach dem Umbruch sich nur Einzelinitiativen durchsetzten und die Pfarrer es verlernten, auf andere zu hören und zuzugehen.
Trotz alledem wurde in den 90er Jahren im Umfeld unserer Kirche der Grund zu einer ganzen Reihe diakonischer Einrichtungen gelegt, die bis heute segensreich wirken und die in mancher Beziehung geradezu Vorbildcharakter tragen.
Ethnische Ă–ffnung
Ethnische Öffnung wurde in jener Zeit und blieb bis heute eine lebensbedingende Notwendigkeit. An verschiedenen Orten des Landes wurden besondere Gottesdienste und Bibelstunden in rumänischer Sprache sowie Arbeit mit Kindern in den Ferien eingerichtet. Rückblickend lässt sich heute sagen, dass diese Bemühungen ethnischer Öffnung keinen spektakulären Erfolg zeitigten und nur in vereinzelten Ausnahmefällen zu Übertritten führten. Sie brachten weder eine Bedrohung der orthodoxen Kirche noch eine wesentliche Veränderung für die evangelische Kirche mit sich. Dennoch waren und sind diese Bemühungen nicht vergeblich, denn sie zeigen, dass sich die evangelische Kirche nicht abschotten und hinter einer sprachlichen Barriere verschanzen will. Verkündigung in rumänischer Sprache ist grundsätzlich in keiner Gemeinde mehr auszuschließen. Bei Kasualhandlungen, an denen in vielen Fällen zahlreiche Nachbarn, Verwandte und Freunde teilnehmen, die nicht zu unserer Kirche gehören, ist es weithin notwendig, die rumänische Sprache mit zu verwenden. Anders ist es bei den Gottesdiensten, in denen sich die evangelischen deutsch sprechenden Gläubigen versammeln. Hier ist Zweisprachigkeit meist nicht erwünscht, was mit dem Gefühl der Identität und Heimat zusammenhängt.
Nun gibt es aber eine Frage, die in den meisten Gemeinden nicht gelöst ist. Vor allem in Landgemeinden, die keine deutsche Schule mehr haben, gibt es evangelisch getaufte Kinder aus Mischehen, die nicht deutsch sprechen und mit denen ihre Pfarrer vor der Konfirmation einen mehr oder minder gründlichen Unterricht in rumänischer Sprache gehalten haben. Wie werden sie weiter in die Gemeinde integriert? Oder sind sie dazu verdammt, Randsiedler der Kirche zu bleiben?
Ein weiteres Problem der ethnischen Ă–ffnung bringt der Religionsunterricht in den Schulen, der nach dem Gesetz optional ist. Das heiĂźt praktisch, dass in den deutschsprachigen Schulklassen vielerorts die Mehrheit der Kinder den evangelischen Religionsunterricht besucht, auch wenn sie anderskonfessionell sind.
Wir haben eine verhältnismäßig starke Gruppe älterer Leute; daneben wächst aber eine junge Generation heran, die ethnisch gemischt und deutsch inkulturiert ist. Wo sie fehlt, stirbt die Gemeinde aus. Daneben sei noch darauf hingewiesen, dass die Zahl der »Sommersachsen« gewachsen ist. In den Städten gibt es zahlreiche Unternehmer oder Mitarbeiter von Unternehmen aus westlichen Ländern, die sich kurz- oder mittelfristig hier niedergelassen haben, daneben Studenten und Praktikanten. Der Gottesdienst ist der Ort, wo sich alles trifft, was deutsch spricht. Diese Leute kommen zu den Einheimischen hinzu und beleben unsere Gottesdienste.
Blick nach vorne
20 Jahre nach dem Umbruch und Exodus dĂĽrfen wir RĂĽckschau halten und auf dem Grund der gemachten Erfahrungen den Weg unserer Kirche beschreiben, dazu Notwendigkeiten und Zielsetzungen aussprechen:
1. Gott hat uns bewahrt, als die Menschen um uns nur Untergang sahen. Er hat uns in den Dienst genommen, und das bedeutet in erster Linie, dass unserem Leben Sinn und Inhalt geschenkt wurde.
2. Unsere Kirche ist nicht mehr so deutsch, wie sie war, aber sie gibt mit Gottes Wort deutsche Kultur und deutsche Sprache weiter und setzt somit die ältere Tradition in angepasster Weise fort.
3. In wesentlich höherem Maße als wir anfänglich zu planen und in Angriff zu nehmen wagten, gelingt die Rettung von Kirchen, Orgeln und anderen Kulturgütern als Symbolen unserer kirchlichen und kulturellen Tradition. Lebendige Kirchenmusik wird gepflegt.
4. Der Schwerpunkt Diakonie, der unmittelbar nach dem Umsturz gesetzt wurde, ist zum festen Bestand unserer Kirche geworden.
5. Grundlage unserer kirchlichen Verwaltung ist das Laienprinzip, demzufolge der Pfarrer zwischen den Presbytern steht, nicht um sie als Helfer und gelegentlich als Aushängeschild zur Verfügung zu haben, sondern um sich mit ihnen zu beraten und mit ihnen gemeinsame Entscheidungen zu treffen. In den Wirrnissen der 90er Jahre wurde kirchliche Demokratie vielfach verlernt.
6. In einer Zeit der akuten Krise der ökumenischen Bewegung kann die Evangelische Kirche A.B. in Rumänien dank ihres Rufs der ethnischen und konfessionellen Offenheit und des diakonischen Engagements auf lokaler Ebene Katalysator im Verkehr der historischen Kirchen unseres Landes sein. Die Evangelische Akademie Siebenbürgen bemüht sich in ihren Tagungen um eine Kultur des sozialen Dialogs. Das Institut für Ökumenische Forschung der Lucian-Blaga-Universität in Hermannstadt bemüht sich vorrangig um das Gespräch zwischen lutherischen und orthodoxen Theologen.
7. Die Rückgabe kirchlicher Liegenschaften, vor allem Wald und Gebäude, aber auch landwirtschaftliche Flächen, haben neue Aufgaben und Möglichkeiten eröffnet. Sie effizient und auch ökologisch verantwortlich zu nutzen ist eine neue Herausforderung der Kirche.
8. Wo Pfarrer gleichzeitig die Hauptverantwortung für Restaurierung von Gebäuden, Kulturarbeit und Wirtschaftsfragen wahrzunehmen haben, ist auch bei geringer Seelenzahl nicht nur die Gefahr der arbeitsmäßigen Überlastung gegeben, sondern vielmehr noch die Gefahr der fachlichen Überforderung. Die Kirche braucht dafür Fachleute, die nicht Theologen sein müssen.
9. Die Mitte des kirchlichen Lebens ist und bleibt der Gottesdienst, die Seelsorge, die kirchliche Unterweisung. Wo der Pfarrer in der Gemeindearbeit ernstlich engagiert ist, sehen es die verantwortÂlichen Mitarbeiter bald ein, dass fĂĽr die anderen Bereiche Fachleute nötig sind.
10. Übers Jahr kommt eine Bischofswahl auf uns zu. Das ist ein ernster Grund, uns Gedanken zu machen, zu suchen und zu beten … Wenngleich diese Frage von aktueller Bedeutung ist, sollte sie uns von der Vorrangigkeit der Frage nach einem richtig geführten geistlichen Amt nicht ablenken. Die Lebenskraft einer Kirche entscheidet sich an der Basis.
Pfarrer i.R. Wolfgang H. Rehner, Sibiu-Hermannstadt/Rumänien
Dieser Aufsatz – die vollständige Fassung soll im Jahrbuch des Martin-Luther-Bundes 2011 erscheinen – wurde im Rahmen der Tagung »Wandel und Zukunftsperspektiven. Kirche und Gesellschaft in Rumänien« im Oktober 2009 in Bad Kissingen gehalten. Wir drucken ihn hier mit freundlicher Genehmigung auszugsweise ab aus: Landeskirchliche Informationen, Nr. 24 vom 31. Dezember 2009.
Auszug aus dem »Lutherischen Dienst« 1/2010. Wenn Sie die weiteren Artikel lesen möchten, z.B. über die Lage in Weißrussland, über die Eröffnung des Evangelischen Hospitals und Diakonissenhauses in St. Petersburg vor 150 Jahren oder das gemeinsame Auftreten der drei großen Diasporawerke Bonifatiuswerk, Gustav-Adolf-Werk und Martin-Luther-Bund auf der 2. Ökumenischen Kirchentag im Mai in München, bestellen Sie den » Lutherischen Dienst kostenlos.